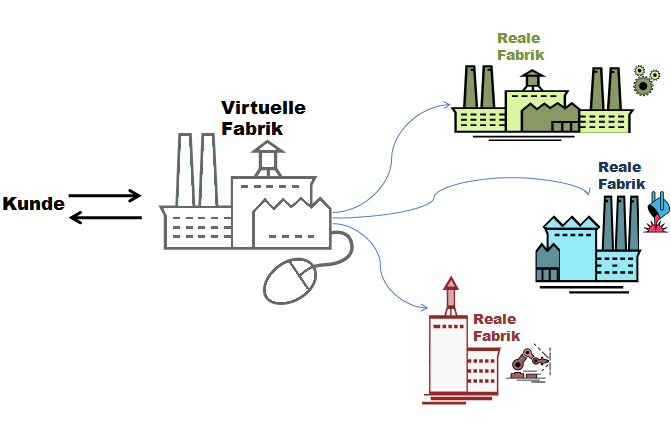Die Erlernbarkeit resultiert im Wesentlichen aus der Erfüllung der übrigen Forderungen an Software.
Insbesondere die Selbstbeschreibungsfähigkeit (Software soll sich selbst erklären können, unter Berücksichtigung der Zielgruppe) und die Erwartungskonformität (der Benutzer soll bekommen, was er mit der Anschaffung und Nutzung der Software erwartet) erleichtern die Erlernbarkeit von Software.
Es sollen die Standardfunktionen der Software sowie die Individualisierbarkeit (Anpassung der Software an individuelle Ansprüche und Vorgaben) so gestaltet werden, dass sie für den Benutzer aus der Zielgruppe leicht durchschaubar und somit für ihn erlernbar sein.
Es kommt wirklich nicht selten vor, dass Benutzer Software verwenden, so wie sie es aus ihrem Umfeld her kennen, ohne dabei die Fähigkeiten in Sachen Individualisierbarkeit auszureizen, weil sich die Funktionen der Individualisierbarkeit und individuelle Funktionen selbst nicht selbstbeschreiben und zusätzlich noch zu kompliziert gestaltet sind.
Die Erlernbarkeit von Software hängt natürlich auch vom Benutzer und seinem Vorwissen ab. Die Erlernbarkeit ist nur dann ausreichend, wenn die Funktionen der Software für jeden Benutzer aus der Zielgruppe, für welche die Software bestimmt wurde, vollständig (mit Ausnahme von versteckten Funktionen, welche nur für die Software-Entwicklung gedacht sind) mit angemessenen Mitteln und vertretbarer Mühe erlernbar sind.
Sicher ist die Erlernbarkeit von Software nicht direkt messbar und auch „angemessene Mittel“ und „vertretbare Mühe“ sind stark Auslegungssache. Der Softwarehersteller muss sich selbstkritisch mit dem Thema auseinandersetzen und eigene, eher pessimistische Maßstäbe setzen.
Andererseits ist die zu gute Erlernbarkeit für den Softwarehersteller manchmal gar nicht so erstrebenswert, wo doch viel Geld mit dem Support und mit Kursen/Zertifikaten gemacht werden kann und das Hauptaugenmerk nun mal leider nicht auf die Softwarequalität gelegt wird. Dennoch sollte jedes Unternehmen zumindest die grundlegenden Funktionen einer Software leicht erlernbar auslegen, so dass nur spezielle Funktionen durch weiteren Support erläutert und somit richtig nutzbar gemacht werden.
Ein sehr gutes Beispiel für einen Durchbruch in Sachen Erlernbarkeit, ist die grafische Benutzeroberfläche, welche durch Microsoft Windows erstmals richtig bekannt wurde und damit als erstes Betriebssystem sich im Heimanwendermarkt etablieren konnte. Während professionelle Computeranwender sich noch lange Zeit überwiegend mit der Konsolenbedienung zufrieden gaben, haben die vergleichsweise ungeduldigen Heimanwender durch die viel schneller erlernbare Grafikoberflächenbedienung Zugang zu der Bedienung des PCs gefunden. Die Grafikoberfläche hatte ihre Nachteile in der größeren Ressourcenlast und führte daher zu Performance-Einbüßen, dennoch war dies im Vergleich doch das geringere Übel.